Anfang – Die Wupper
Geboren und aufgewachsen an der Tiroler Ache, was auch heute wieder meine Adresse ist, bin ich nach Umwegen 1972 an die Münchner Falkenbergschule und von dort als Assistent an die Münchner Kammerspiele gekommen.  Engagiert hatten mich der damalige Oberspielleiter Johannes Schaaf. Rosemarie Fendl hatte für mich geworben, ihnen beiden habe ich meinen Einstieg ins Theater zu verdanken. Adolf Dresen machte in dieser Zeit – er war der erste Gastregisseur, der aus der DDR einreisen durfte – „Die Wupper“.
Engagiert hatten mich der damalige Oberspielleiter Johannes Schaaf. Rosemarie Fendl hatte für mich geworben, ihnen beiden habe ich meinen Einstieg ins Theater zu verdanken. Adolf Dresen machte in dieser Zeit – er war der erste Gastregisseur, der aus der DDR einreisen durfte – „Die Wupper“.
Es war eine aufregende Arbeit vor einem großen, weiten Hintergrundwissen über die Gesellschaft zur Zeit von Lasker-Schülers Wuppertal, ihrem Leben und gesamten Werk. Dresen und seine Dramaturgin Ilse Galfert brachten ein Wissen, eine ungeheure Bildung mit, die im Westen völlig ungewöhnlich war. Und ich durfte assistieren.

Von einem der auszog das Fürchten zu lernen bis zu den Rassen
1975 kam ich, erst noch als Assistent, nach Frankfurt zu Peter Palitzsch, wo ich dann im zweiten Jahr meine erste Inszenierung in Co-Regie mit ihm machte, ‚ein Weihnachtsmärchen’. Das nächste Märchen durfte ich dann  schon allein inszenieren und auch die Bearbeitung selber schreiben „Von einem der auszog das Fürchten zu lernen“. Mir waren die damals üblichen Märchenbearbeitungen zu harmlos, zu ‚sozialphilharmonisch’.
schon allein inszenieren und auch die Bearbeitung selber schreiben „Von einem der auszog das Fürchten zu lernen“. Mir waren die damals üblichen Märchenbearbeitungen zu harmlos, zu ‚sozialphilharmonisch’.
Mir schien es falsch, die Kinder schützen zu wollen, viel wichtiger ist, dass sie erleben können, wie man in der Phantasie vergnüglich die schwarze Seite unserer Seele ausleben und dabei abarbeiten kann – eine Art „Schwarzarbeit“. Es wurde dank der Ausstattung von Nina Ritter auch vom Bild her eine tolle Inszenierung.
Die letzten beiden Jahre der Intendanz von Peter Palitzsch war ich dort erstmals als fest angestellter Regisseur engagiert. Meine wichtigste Arbeit war „Rassen“ von Bruckner mit Michael Altmann, Peter Danzeisen und Axel Wagner, mit dem ich auch einige Jahre zusammen in einer Wohnung lebte. Sehr viel, auch was ich über Theater und Musik weiß, verdanke ich Axel.
 Ich habe mit diesem Stück, das Bruckner auf seiner Flucht vor Nazideutschland geschrieben hatte, versucht meine problematischen Erfahrungen mit den 68-ern zu thematisieren. War ich doch mit so Vielen, begeistert von dem Gefühl aus der klein bürgerlichen Isolierung befreit zu sein, auf die Straße gelaufen und hatte irgendwelche Slogans mit gebrüllt, ohne mir klar zu sein, was ich da in den Mund nahm. Mein Glück war, für Einen meiner Generation stand ich wohl auf der ‚richtigen’ Seite...
Ich habe mit diesem Stück, das Bruckner auf seiner Flucht vor Nazideutschland geschrieben hatte, versucht meine problematischen Erfahrungen mit den 68-ern zu thematisieren. War ich doch mit so Vielen, begeistert von dem Gefühl aus der klein bürgerlichen Isolierung befreit zu sein, auf die Straße gelaufen und hatte irgendwelche Slogans mit gebrüllt, ohne mir klar zu sein, was ich da in den Mund nahm. Mein Glück war, für Einen meiner Generation stand ich wohl auf der ‚richtigen’ Seite...
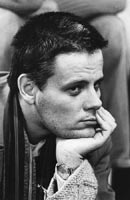 Wir schreiben das Jahr 1980. Die Intendanz von Peter Palitzsch ist beendet. Das Modell Mitbestimmung ist ausgeträumt und es erscheint das Buch zu diesen aufregenden 10 Jahren unter dem Titel ‚War da was?’.
Wir schreiben das Jahr 1980. Die Intendanz von Peter Palitzsch ist beendet. Das Modell Mitbestimmung ist ausgeträumt und es erscheint das Buch zu diesen aufregenden 10 Jahren unter dem Titel ‚War da was?’.
Posada, oder der große Coup im Hotel Ritz
Boy Gobert holte mich 1980 ans Schillertheater. Ich durfte seine Berliner Intendanz am Schlossparktheater, damals zweite Spielstätte des Schillertheaters, eröffnen. Ich inszenierte die Uraufführung von Mareluise Fleißers „Tiefseefisch“ mit Elisabeth Rath und Dieter Laser. Noch während den Proben bot mir Gobert den Oberspielleiterposten an. Ich konnte nicht annehmen, zu fern schien mir diese Art von Theaterbetrieb von dem, was da in Frankfurt so intensiv – manchmal sogar mit Humor – gesucht wurde. „Tiefseefisch“ wurde ein großer Erfolg, die Presse war begeistert, das Haus glücklich. Peter Zadek erteilte mir den ‚Ritterschlag’. Das war nach der Premiere im Foyer, er kam auf mich zu und gratulierte. Thomas Reichert war in Berlin angekommen.



Ein ganz besonderes Highlight wurde die Uraufführung von „Posada, oder der große Coup im Hotel Ritz“ von Walter Serner mit Sabine Sinjen und Peter Matic. Keiner hatte zuerst daran geglaubt, dass es möglich sei, dieses Stück des großen Dadaisten auf die Bühne zu bringen, aber mit Serners Text „Letzte Lockerungen“ unterm Kopfkissen gelang es und wurde auch ein großer Publikumserfolg.
Dazwischen inszenierte ich „Amphitryon“. Begeistert von diesem Text, versuchte ich ihn in seiner ganzen Fülle auf die Bühne zu bringen, also Kleists Sicht auf die Geschichte, nicht den flotten Dreier, der bei Moliere die Hauptrolle spielt, sondern die Unvereinbarkeit von Macht und menschlichem Gefühl. So wurde es schliesslich mehr das Stück über Einsamkeit und Liebe,  Einsamkeit in der Liebe, denn eine Komödie. Das Bühnenbild dazu schuf, wie auch schon beim Tiefseefisch, Nina Ritter. Die Premiere bleibt mir unvergessen. Von den ersten Verbeugen der Schauspieler an wurde ausgepfiffen, man wartete gar nicht erst auf die Regiemannschaft. Die Kritiken habe ich aufbewahrt, sie sollten sich das Vergnügen nicht entgehen lassen.
Einsamkeit in der Liebe, denn eine Komödie. Das Bühnenbild dazu schuf, wie auch schon beim Tiefseefisch, Nina Ritter. Die Premiere bleibt mir unvergessen. Von den ersten Verbeugen der Schauspieler an wurde ausgepfiffen, man wartete gar nicht erst auf die Regiemannschaft. Die Kritiken habe ich aufbewahrt, sie sollten sich das Vergnügen nicht entgehen lassen.
Sturm und Drang
Mit einer Zeichnung von Georg Herold
Es war ein wenig kälter um mich herum geworden. Ich musste Berlin verlassen. Aber zum Abschluss wollte ich dort ein Projekt machen, das mir schon länger sehr am Herzen lag, eine einstündige Bearbeitung von Klingers „Sturm und Drang“, reduziert auf fast keine Handlung und 7 Personen, also Maria Hartmann, Sona Mc Donald, Liselotte Rau und bei den Männern erinnere ich besonders Axel Radler, der bei Gobert für ein Weiterspielen der Aufführung kämpfte, weil sie zwar schlecht besucht, aber ungeheuer wichtig sei. Und wie schon bei Posada arbeitete ich wieder mit dem Künstler Georg Herold zusammen. Wir waren auf der Höhe der Zeit, der Misserfolg zwar groß, aber Georg und ich uns sicher, dass das Theater einfach viel zu weit hinter den Entwicklungen der Kunstszene zurück hinke.
Freiburg mit Barbara Melzl und Henning Heers
Freiburg, das war für mich vor Allem die Zusammenarbeit mit den Schauspielern dort, allen voran Barbara Melzl und Henning Heers. Beide konnte ich später nach Hannover holen und sie kamen auch mit nach München ans Residenztheater. 1983 „Was ihr wollt“ mit Barbara als Viola und Sebastian und Henning Heers als Malvolio, Anke  Schubert als Herzog. Dann machten wir „Kasimir und Karoline“, ich zum ersten Mal auch das Bühnenbild, Thomas Reichert, Theater Regisseur und Christoph Marthaler die Musik. Als letzte Arbeit in Freiburg „Maria Stuart“, wieder in toller Besetzung. Wir haben die längste Zeit der Proben in irgendwelchen Übungsräumen zugebracht, um die faszinierende Rhythmik des Schillertextes auf heutige Art laut werden zu lassen. Das Bühnenbild entwarf Michael Simon, mit dem ich später immer wieder zusammenarbeitete.
Schubert als Herzog. Dann machten wir „Kasimir und Karoline“, ich zum ersten Mal auch das Bühnenbild, Thomas Reichert, Theater Regisseur und Christoph Marthaler die Musik. Als letzte Arbeit in Freiburg „Maria Stuart“, wieder in toller Besetzung. Wir haben die längste Zeit der Proben in irgendwelchen Übungsräumen zugebracht, um die faszinierende Rhythmik des Schillertextes auf heutige Art laut werden zu lassen. Das Bühnenbild entwarf Michael Simon, mit dem ich später immer wieder zusammenarbeitete.
Die Räuber
Wieder zurück in Frankfurt
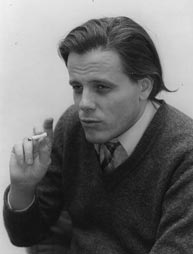 Horst Laube, der große Dramaturg und wesentlicher Gestalter der Zeit der Mitbestimmung bei Peter Palitzsch, war wieder in Frankfurt, wo Adolf Dresen Intendant war. Und so kam ich wieder an das Haus. Zuerst mit „Sommer“ von Bond. Ein gut gebautes, wirkungsvolles Stück Theater, ‚linkes’ Theater und so in seiner letzten Aussage ein wenig naiv. Sozialistensohn und Kapitalistentochter tun sich zusammen, am Horizont der neue Mensch. Ich konnte das so klebrig nicht stehen lassen und setzte an den Schlussdialog der beiden Jungen den Satz: „Wir telefonieren“ und – Alles war wieder offen. Aber so was galt als krasse Eigenmächtigkeit und war damals nicht gern gesehen. Es war eine wunderbar verrückte Probenzeit mit Rosemarie Fendl und Ingrid Engelmann, die ich dafür von Düsseldorf geholt habe.
Horst Laube, der große Dramaturg und wesentlicher Gestalter der Zeit der Mitbestimmung bei Peter Palitzsch, war wieder in Frankfurt, wo Adolf Dresen Intendant war. Und so kam ich wieder an das Haus. Zuerst mit „Sommer“ von Bond. Ein gut gebautes, wirkungsvolles Stück Theater, ‚linkes’ Theater und so in seiner letzten Aussage ein wenig naiv. Sozialistensohn und Kapitalistentochter tun sich zusammen, am Horizont der neue Mensch. Ich konnte das so klebrig nicht stehen lassen und setzte an den Schlussdialog der beiden Jungen den Satz: „Wir telefonieren“ und – Alles war wieder offen. Aber so was galt als krasse Eigenmächtigkeit und war damals nicht gern gesehen. Es war eine wunderbar verrückte Probenzeit mit Rosemarie Fendl und Ingrid Engelmann, die ich dafür von Düsseldorf geholt habe.
Dann „Die Räuber“ von Schiller. Wieder interessierte mich am Meisten, wie so eine Vereinigung zusammen kommt, wie sich Treue auf Tod und Teufel schwört und bei allen Wiederständen, intern wie extern, zusammen bis ins Ende bestehen bleibt. Es spielten u. a. Andre Jung, Thomas Thieme, Martin Wuttke, Thomas Anzenhofer, Rufus Beck.
Top Girls
Gerd Heinz und sein Chefdramaturg Peter Rüedi hatten mich 1983 an das Zürcher Schauspielhaus geholt, wo es nicht nur diese wunderbare Leitung gab, sondern auch tolle Schauspielerinnen.
„Top Girls“, mit Sieben von ihnen  inszenierte ich das Stück von Caryl Churchill über die Blüten weiblicher Emanzipation. Mich faszinierte nicht nur, wie die Churchill mit der Thematik umging, sondern vielleicht vor Allem, wie sie den Text rhythmisch notiert hatte; das Sprechen zu zweit, manchmal zu dritt. Dabei waren Eva Rieck als ‚Marlene’, Ursula Andermatt als ‚Tolle Grete’ und Reinhild Solf, Renate Schröder. Das Bühnenbild von Stefan Mayer, die Kostüme Stephanie Geiger.
inszenierte ich das Stück von Caryl Churchill über die Blüten weiblicher Emanzipation. Mich faszinierte nicht nur, wie die Churchill mit der Thematik umging, sondern vielleicht vor Allem, wie sie den Text rhythmisch notiert hatte; das Sprechen zu zweit, manchmal zu dritt. Dabei waren Eva Rieck als ‚Marlene’, Ursula Andermatt als ‚Tolle Grete’ und Reinhild Solf, Renate Schröder. Das Bühnenbild von Stefan Mayer, die Kostüme Stephanie Geiger.
Victor oder die Kinder an der Macht
André Jung und Norbert Schwientek
Die Faszination der Arbeit in Zürich war die Zusammenarbeit mit den Partnern auf der Bühne. Norbert Schwientek hatte ich mit Peter Rüedi vom Schillertheater geholt und André Jung, wir haben bei den „Räubern“ zusammengearbeitet, aus Frankfurt. Diese Schauspieler und die Schauspielerinnen, die ich zum Teil schon genannt habe, dazu noch Maria Becker, gaben dem Theater am Pfauen das Außergewöhnliche.
Sardanapal
zu den Junifestwochen 1987 von Lord Byron. Bühne und Kostüme wieder von Nina Ritter und auch die Musik wieder von Christoph Marthaler.


SARDANAPAL, ein Stück am Rande der Phantasie,
deren Zentrum und Motor der Klang Ninive,
erinnert an Namen wie Babylon, Atlantis, Rom
und lässt deren Schicksal vermuten.
Das Schicksal des fetten Nordens morgen.
Ninive, Hauptstadt der bekannten Welt,
mehr Geschwür als Metropole,
fett auf Kosten dieser Welt,
riesige Gärten, künstlich bewässert
und Mauern, sich zu schützen, so gewaltig:
«Dass diese Stadt vor Menschen nie erliege
solange nicht der Strom ihr Gegner wird.»
In der Mitte der König, noch behütet
vor der Wirklichkeit des «Aus und Vorbei».
Der König spielt, gespielt wird Liebe
wie jeden Tag seit dieser Herrscher ist.
Das unregierbare Reich stöhnt und ächzt,
der König tritt Assyriens Tugenden mit Füssen
ein Narr, den man vergessen hat
am Aschermittwoch auszuwechseln.
(Text von Thomas Reichert)
1986, mit demselben Team die böse Komödie „Victor oder die Kinder an der Macht“ von Roger Vitrac, neben Schwientek als Victor, Jung, Rieck, Wildenauer, Cziesla und Babette Arens als Esther.

Was haust in uns das hurt lügt raubt und mordet
1985 „Britannicus“ von Racine mit Norbert Schwientek als kindlicher Nero, Maria Becker als seine Mutter. Ausstattung von Nina Ritter. Wie können aus Kindern so böse Erwachsene werden? Ein schrecklich guter Text auf der Suche: ist da eine Seele und wenn ja wie viele und wer ist Schuld an wessen Abgründen?
Meine wichtigste Lektüre, um die in ihrer Struktur immer krimiartigen Stücke von Racine fassen zu können, war Ross McDonald’s „Blauer Hammer“ - eine vergnügliche Empfehlung damals von Francoise Bondy.
Den Sitz der Seele mit dem Messer suchend
Dieser genial geklaute Satz von Heiner Müller aus „Titus Andronicus“ ist der Leitsatz für meine Arbeit geworden.
Der Auftrag
1988 begann ich mit Eberhard Witt seine neue Intendanz für das Schauspiel Hannover vorzubereiten. 1989 ging ich dann als fester Regisseur und künstlerischer Leiter nach Hannover.
Wir engagierten Schauspieler wie Barbara Melzl, Alfred Kleinheinz, Henning Heers und Anfänger wie Jan-Gregor Kremp, Oliver Stokowski und Juliane Köhler, die dort bald zu Stars heranwuchsen. So entstand in recht kurzer Zeit ein sehr gutes, ganz besonderes, neugieriges Ensemble, voller Spiellust.
 Aus dem Kern dieses Ensemble heraus entstand auch der "Auftrag", der alle Heiner Müller-Vorurteile von übergescheiten, trockenen, schwer spielbaren Texten Lügen strafte. Wir spielten das Stück von April 89 bis Sommer 90, das war sicher die spannendste Aufführungsserie, die ich je erlebt habe – war doch fast bei jeder Vorstellung die politische Wetterlage schon wieder eine andere. Die Grenze ging auf. Ost-West, dieser Konflikt veränderte drastisch seine Bedeutung. Als wir z.B. mit dem Stück in Leipzig gastierten, war dort gerade die CDU an die Macht gekommen und auf der Bühne hörte man von Westdeutschen den Satz "Die Revolution hat keine Heimat mehr, das ist nicht neu unter dieser Sonne ...". Da knarzten im Zuschauerraum nicht nur die alten Holzstühle.
Aus dem Kern dieses Ensemble heraus entstand auch der "Auftrag", der alle Heiner Müller-Vorurteile von übergescheiten, trockenen, schwer spielbaren Texten Lügen strafte. Wir spielten das Stück von April 89 bis Sommer 90, das war sicher die spannendste Aufführungsserie, die ich je erlebt habe – war doch fast bei jeder Vorstellung die politische Wetterlage schon wieder eine andere. Die Grenze ging auf. Ost-West, dieser Konflikt veränderte drastisch seine Bedeutung. Als wir z.B. mit dem Stück in Leipzig gastierten, war dort gerade die CDU an die Macht gekommen und auf der Bühne hörte man von Westdeutschen den Satz "Die Revolution hat keine Heimat mehr, das ist nicht neu unter dieser Sonne ...". Da knarzten im Zuschauerraum nicht nur die alten Holzstühle.

Davor, 1989 habe ich die "Möve" in Hannover zur Eröffnung inszeniert. Die Jugend und deren große „Chance zu scheitern“ das Thema; das alte und neue Ensemble zusammenzubringen die Aufgabe.  Und auch in der ersten Spielzeit zwei Einakter von Havel zusammen mit Becketts Hommage an ihn: "Katastrophe". Havel war damals mal wieder ins Gefängnis gesteckt worden. Jan-Gregor Kremp wurde in der Rolle des Braumeisters bereits zu diesem Zeitpunkt ein Liebling des Publikums.
Und auch in der ersten Spielzeit zwei Einakter von Havel zusammen mit Becketts Hommage an ihn: "Katastrophe". Havel war damals mal wieder ins Gefängnis gesteckt worden. Jan-Gregor Kremp wurde in der Rolle des Braumeisters bereits zu diesem Zeitpunkt ein Liebling des Publikums.
Kabale und Liebe
Im zugespitzten Bühnenraum von Michael Simon, einem radikalen Nichts, was die Spielfläche betraf, drängten sich die von falschen Interessen Getriebenen ihrem jeweiligen K.O. entgegen. Alfred Kleinheinz als Wurm, der Luise so sehr wie hoffnungslos liebt, dass er die Intrige zu Hilfe nehmen muß, um wenigstens eine Szene mit ihr  spielen zu können... Und Luise, die mit der Kraft ihrer Sehnsucht die Milford der Elisabeth Rath immer wieder von der Bühne treibt. Sie, Juliane Köhler und Ferdinand, Jan-Gregor Kremp, die wunderschön zusammen musizieren können, sie Cello er Klavier, aber in so gänzlich anderen Wirklichkeiten gefangen sind. Aber Theater ist gnädig: Ferdinand und Luise dürfen zusammen sterben, alle anderen müssen als Krüppel weiterleben.
spielen zu können... Und Luise, die mit der Kraft ihrer Sehnsucht die Milford der Elisabeth Rath immer wieder von der Bühne treibt. Sie, Juliane Köhler und Ferdinand, Jan-Gregor Kremp, die wunderschön zusammen musizieren können, sie Cello er Klavier, aber in so gänzlich anderen Wirklichkeiten gefangen sind. Aber Theater ist gnädig: Ferdinand und Luise dürfen zusammen sterben, alle anderen müssen als Krüppel weiterleben.
Das weite Land
Schnitzler gehört auch zu den Autoren, die völlig unsentimental und wenig wertend dieses Geschöpf Mensch unters Messer nehmen. Ich erschrecke oft bei Schnitzlers Texten: „Oh Gott, woher weiß der das?“ und diese Schrecken versuche ich auf die Bühne zu bringen. Als Regieanfänger in Frankfurt hatte ich schon drei Einakter von Schnitzler inszeniert: "Überspannte Person", "Das Bachusfest" und "Halb Zwei". Diese Arbeit, das dabei immer größer werdende Interesse an den Abgründen der Seele, hat mich sehr geprägt. 1990 also machte ich in Hannover "Das weite Land". In einem Bühnenbild von Nina Ritter spielten Juliane Köhler, Elisabeth Rath als Genia, Henning Heers als Hofreiter, Alfred Kleinheinz als Mauer, und als Dichter Rohn Jan Gregor Kremp.
Warten auf Godot,
ganz jung besetzt, wurde eine äußerst vergnügliche und überaus spannende Produktion, auch weil ich das Stück erst im ‚Alten Magazin’ herausbrachte und es zwei Jahre später auf der neu erbauten Spielstätte ‚Probebühne’ wiederaufnahm. Jan-Gregor Kremp (28 Jahre) und Oliver Stokowski (27 Jahre) spielten Vladimir und Estragon. Das Warten war für die Beiden zuerst so gar kein metaphysisches Thema, sondern ganz handfest: warten auf einen Studienplatz, aufs nächste Vorsprechen auf den Anruf, das Engagement, das Honorar...
Glaube Liebe Hoffnung
Juliane Köhler betrat allein und ein wenig scheu als Erste die große Bühne des neu gebauten Schauspielhauses in Hannover. Mehr als ein neues Kapitel in der Geschichte des Hannover`schen Theaters war damit eröffnet. Beim dritten Versuch einen würdigen Ersatz für das im Krieg zerstörte Schauspielhaus zu schaffen, gelang und es war endlich so weit.
‚Ausgerechnet  Bananen’, der berühmte Schlager aus den Jahren der Weltwirtschaftskrise, als Horvath das Stück geschrieben hatte, waren die ersten Töne, die Juliane vor sich hinträllerte, um sich ein wenig Mut zu machen auf dem Weg zu den Präparatoren, denen sie ihrer Leiche für ein paar Mark verkaufen wollte, jetzt wo auch sie ihre Arbeit verloren hat...
Bananen’, der berühmte Schlager aus den Jahren der Weltwirtschaftskrise, als Horvath das Stück geschrieben hatte, waren die ersten Töne, die Juliane vor sich hinträllerte, um sich ein wenig Mut zu machen auf dem Weg zu den Präparatoren, denen sie ihrer Leiche für ein paar Mark verkaufen wollte, jetzt wo auch sie ihre Arbeit verloren hat...
Die Kosten der Einheit hatten den Glauben an die Wirtschaftsmacht Deutschland endgültig erschüttert. Das war der Zeitpunkt der Eröffnung des neuen Hauses zu dem es große Reden gab und Politiker die sich plötzlich alle als Kunst-Ermöglicher hinstellten. In dieser Situation schien es mir notwendig auch den Verlierern unserer Gesellschaftsordnung eine Stimme zu geben. Thorsten Nindel als Schupo, Jan-Gregor Kremp als Präparator, Barbara Melzl, Thomas Limpinsel und vielen mehr in Nina Ritters Bühnenraum von gespenstisch kalter Architektur.
Es war ein mal ein Mensch der oft stolperte, natürlich lachten ihn jedes Mal alle aus. Eines Tages, er war schon sehr traurig, täuschte er einen Stolperer vor. Alle lachten. Da wusste er, was er zu tun hatte.
Eine Boulevardkomödie pro Spielzeit war auch eine der Aufgaben, die wir uns für unser Ensemble gestellt hatten. Türe auf, Türe zu und dazwischen, meist sehr schnell, Sätze präzise platzieren. Es gibt keine bessere Stückgattung für Berufsanfänger das Handwerk der Schauspielerei zu erlernen als diese Art Komödien. Musikalität und ein genaues Gespür was zwischen Bühne und Zuschauerraum vorgeht, sind wesentliche Vorraussetzungen für gute Pointen, damit der Zuschauer auf seine Kosten kommt in der ‚schrecklichen’ Freude des: Gott sei dank, dass ich’s nicht bin. Ich inszenierte "Komödie im Dunkeln" 1991 und "Othello darf nicht platzen" 1993, harte Proben waren das, aber wie schön, wenn ein ganzer Zuschauerraum lacht.
Abschied
Vier Jahre voller schöner, aufregender Arbeiten habe ich in Hannover verbracht, der Stadt an der Leine, erst im alten Ballhof, der zwischen den Kriegen eine Kneipe war – berühmt durch einen Stammgast, durch vielleicht Hannovers prominentesten Sohn, Fritz Haarmann. „Das ist der, wo es so ‚schöne’ Kinderreime von gibt“. Dann im 4ten Jahr Umzug in das neuerbaute Schauspielhaus an der Prinzenstrasse.
Auch  steht in Hannover das Sprengelmuseum, voll von Werken der klassischen Moderne. Viele Nachmittage bin ich dorthin spaziert. Prominente Hannoveraner wurden alle Jahre mal gebeten, eine Führung nach ihren Vorlieben und Interessen durch dieses Museum zu machen. Ich wurde auch dazu eingeladen, es war eine ganz besondere Ehre und … ein Vergnügen.
steht in Hannover das Sprengelmuseum, voll von Werken der klassischen Moderne. Viele Nachmittage bin ich dorthin spaziert. Prominente Hannoveraner wurden alle Jahre mal gebeten, eine Führung nach ihren Vorlieben und Interessen durch dieses Museum zu machen. Ich wurde auch dazu eingeladen, es war eine ganz besondere Ehre und … ein Vergnügen.
1993 "Frau vom Meer", eine Zerreissprobe zwischen Traum und Wirklichkeit, Sehnsucht und Leben von Ibsen mit Alfred Kleinheinz als Dr.Wrangel, Elisabeth Rath, Natalie Seelig, Werner Heindl.
Ich habe eine wehmütige Erinnerung an diese Arbeit, sicher auch, weil sie die letzte meiner Arbeiten in Hannover war.
Ab nach München
Der Erfolg schwemmte uns ans Resi. Das Haus war voll in Hannover, die Zuschauer mochten uns, das Ensemble war homogen und Theaterleute, die uns besuchten, waren beeindruckt. Ich erinnere noch an Wilfried Minks: er hätte nicht geglaubt das so ein Zusammenhalt, so ein Klima an einem Staatstheater möglich sei.
Aber das war es natürlich nicht, was uns nach München brachte.
In einer frühen Saisonbilanz im ‚Theater Heute’ wurden wir sehr positiv gewertet. Und in einem Teil davon, welcher Henning Rischbieter verfasst hat, war anhand der Aufführung „Macbeth“ Regie: D. Gotscheff und „Auftrag“ Regie: Thomas Reichert vom „Theaterwunder Hannover“ die Rede. Da war es, ein Wunder, denn viele Kritiker in Ermangelung von Eigeninitiative oder geplagt von ständigen Entzugserscheinungen nahmen es 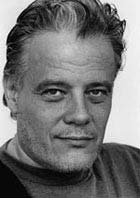
 gierig auf. Wie ein Ball, den man sich zuwarf über die Köpfe der Betroffenen hinweg, die natürlich nicht anders konnten als zumindest ab und zu begierig die Hände danach zu strecken und ein wenig in die Höhe zu hopsen. Und da saß man dann plötzlich in den Armen der Ballwerfer oder ist ausgerutscht und sitzt anders im Dreck. Aber das Spiel war angepfiffen und viele wollten dabei sein und hatten keine Zeit zu schauen ob der Ball nicht vielleicht ein Luftballon ist, den der Wind schnell verbläst oder er platzt. Ganz wichtig auch die Spielverderber, deren Rolle gerade beim Aufrechterhalten – speziell von sinnlosen Spielen – nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Der Anlass dieses Spiels – wir – wir waren plötzlich eine Hoffnung. Das ging alles sehr schnell, eine Gesellschaft ohne Zukunft braucht immer Alles – und zwar sofort; aber so wurden wir‚ wie man so sagt überregional bekannt. Dieser Erfolg brachte uns ans Bayrische Staatsschauspiel München. Intendant: Eberhard Witt, Künstlerische Leitung: Matthias Fontheim, Matthias Hartmann, Amélie Niermeyer und ich.
gierig auf. Wie ein Ball, den man sich zuwarf über die Köpfe der Betroffenen hinweg, die natürlich nicht anders konnten als zumindest ab und zu begierig die Hände danach zu strecken und ein wenig in die Höhe zu hopsen. Und da saß man dann plötzlich in den Armen der Ballwerfer oder ist ausgerutscht und sitzt anders im Dreck. Aber das Spiel war angepfiffen und viele wollten dabei sein und hatten keine Zeit zu schauen ob der Ball nicht vielleicht ein Luftballon ist, den der Wind schnell verbläst oder er platzt. Ganz wichtig auch die Spielverderber, deren Rolle gerade beim Aufrechterhalten – speziell von sinnlosen Spielen – nicht hoch genug eingeschätzt werden kann. Der Anlass dieses Spiels – wir – wir waren plötzlich eine Hoffnung. Das ging alles sehr schnell, eine Gesellschaft ohne Zukunft braucht immer Alles – und zwar sofort; aber so wurden wir‚ wie man so sagt überregional bekannt. Dieser Erfolg brachte uns ans Bayrische Staatsschauspiel München. Intendant: Eberhard Witt, Künstlerische Leitung: Matthias Fontheim, Matthias Hartmann, Amélie Niermeyer und ich.
Die Wildente 1993, eine grausame Geschichte um eine Wette zwischen Vater und Sohn. Ob und wie weit sich eine von ihnen finanziell abhängige Familie korrumpieren lässt. Ob Geld zählt oder Freundschaft und Moral. Das 19te Jahrhundert geht unter im alten Ekdal. Anrührend gespielt von Kurt Meisel, es sollte seine letzte Arbeit sein, er starb unmittelbar vor unserer Derniere.
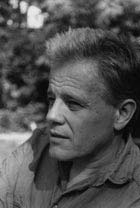 Am Dachboden spielt diese Komödie der Blindheit. Die Zukunft wird aus Versehen erschossen: die Wildente gespielt von Natalie Selig. Mittendrin Gina, die Mutter, die alles weiß, aber um den Preis des Überlebens alles ausgleichen will. Durch das großartige Spiel von Eva Rieck bekam diese Rolle das Gewicht und die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt. Oliver Stokowski als ihr Mann, der naiv gefährlich durch das Leben dümpelt, lacht und nicht merkt das ihm nur der Platz des Verlierers bleibt. Sein Kind ist nicht sein Kind, seine Arbeit nicht seine Arbeit. Alfred Kleinheinz als Doktor, der immer eine intelligente Begründung für den Sieg der Vergangenheit über die Zukunft parat hat. In der Situation des Fehlens jeglicher durch Utopie bestimmten Zukunft, sind alle gierig auf kluge Entschuldigungen.
Am Dachboden spielt diese Komödie der Blindheit. Die Zukunft wird aus Versehen erschossen: die Wildente gespielt von Natalie Selig. Mittendrin Gina, die Mutter, die alles weiß, aber um den Preis des Überlebens alles ausgleichen will. Durch das großartige Spiel von Eva Rieck bekam diese Rolle das Gewicht und die Aufmerksamkeit, die ihr gebührt. Oliver Stokowski als ihr Mann, der naiv gefährlich durch das Leben dümpelt, lacht und nicht merkt das ihm nur der Platz des Verlierers bleibt. Sein Kind ist nicht sein Kind, seine Arbeit nicht seine Arbeit. Alfred Kleinheinz als Doktor, der immer eine intelligente Begründung für den Sieg der Vergangenheit über die Zukunft parat hat. In der Situation des Fehlens jeglicher durch Utopie bestimmten Zukunft, sind alle gierig auf kluge Entschuldigungen.
Die Mutter in der Urfassung von Maxim Gorki, geschrieben 1909, als Gorki noch nicht wissen konnte wohin sich das alte Jahrhundert auflösen wird. Die Männer sind schwach geworden. Wassa, gespielt von Margit Carstensen – eine sagenhaft Begegnung war das mit dieser so wunderbar kindlich neugierigen Frau – versucht den Sauladen noch irgendwie zusammenzuhalten, versucht ihre Söhne als Erben auszuboten. Sie weiß, die haben das Unternehmen in Null-Zeit ruiniert. Wassa will es ihren Schwiegertöchtern übergeben. Dazu müssen sich drei verstrittene und gnadenlosen Frauen zusammentun. Sie können sich zwar nicht riechen, wissen aber, das sie diesen Männern nichts mehr überlassen dürfen. Assistiert wird Wassa von einem korrupten Angestellten, wunderbar gespielt von Alfred Kleinheinz.
Eingebildeter Kranker 1994 am Residenztheater wieder mit Nathalie Seelig, Alfred Kleinheinz, Timo Dierkes und Johanna Gastdorf. Eine bearbeitende Übersetzung von mir nach Kortner liegt beim Verlag ‚Bloch Erben’.
Andromache
Die deutsche Erstaufführung dieses Stückes von Racine war ein besonderer Höhepunkt meiner Arbeit am Residenztheater. In der präzisen wie musikalisch perfekten Übersetzung von Simon Werle, ein Vergnügen der besonderen Art.
Orest liebt Hermione, die Pyrrhus liebt, der Andromache liebt, die Hektor liebt, der tot ist. Die Konstellation der Liebeskette ist an die Stelle des Mythos getreten, um eine unentrinnbare Situation zu bezeichnen, in der das Subjekt nicht bekommt, was es am sehnlichsten wünscht. Der oder die Andere bleiben immer nur begehrtes Objekt, werden nicht geachtetes Subjekt und so bleibt nur Haben wollen oder Verachtung als große Gefühle und statt Handeln Taktieren. Und so hat das Stück nur scheinbar Handlung, ist Struktur und spielt gnadenlos durch die Mechanik der Affekte. Juliane Köhler sagte mal bei den Proben, das ist ja in den Abläufen wie bei der Fernsehserie „Dallas“ nur statt der Mauerschau gibt’s halt Telefon.
Juliane Köhler spielte Hermione, Christiane Rossbach Andromache, Timo Dierkes Orest dazu Steffen Wink, Judith Hofmann, Lukas Miko, Lars Wellings ünd Lara Körte. Daniela Kranz war meine Assistentin, sie, die ich noch in Hannover ins Team geholt hatte und die sicher die selbstständigste und spannendste Assistentin an meiner Seite war.
Ich verließ München 1995
Erst unmerklich, dann immer offensichtlicher hatte es uns auch erwischt, es zählte, als wir in München waren, tatsächlich nur mehr der Erfolg im Feuilleton und natürlich die Angst, ihn nicht zu haben. Und aller Inhalt, aller Grund warum wir zusammen Theater machen wollten, war auf der Strecke geblieben und so kämpften wir um jede ‚gute’ Zeile in fast jedem Blatt. Der Zuschauerraum war zwar immer ziemlich voll, wir dagegen oft recht leer. Es gab gute Produktionen, aber sie konnten nicht wirklich stark werden ohne das gemeinsame Wollen unter dessen Prämisse wir angetreten waren. Und so fanden wir uns ganz schnell in einem hochsubventionierten, zwar gut besuchten aber mittelmäßigen Staatstheater mit der üblichen Kantinenstimmung wieder. Ich konnte nicht wirklich dagegenhalten und verließ das Haus nach zwei Jahren.
Wieder unterwegs, auf der Suche
In Weimar beim Kunstfest 1996 hatte ich die Möglichkeit selbst zu spielen in Heiner Müllers Bildbeschreibung, inszeniert von Michael Simon, der mich zunächst als Dramaturg zu dieser Arbeit geholt hatte. Bildbeschreibung, ein einziger Satz, acht Seiten lang. Ein Stück Prosa fürs Theater geschrieben.
Müller verweigert jede Art von Handlung mit einem Anfang, Höhepunkt, Ende. Die traditionelle Bewegung von rechts nach links, von oben nach unten ist, wenn vorhanden, beliebig, eine gefährliche Schleuderbewegung, eine Reise in die Zeit. Und der da sieht und beschreibt ist fest, völlig unbeweglich auf einem Stativ befestigt. Sein Auge, sein – lidloser – Blick in unverrückbarer Position, wie eine Kamera, die in defekt rasendem Zoom sich aufs Bild zubewegt, stolpernd, stotternd, die Bewegung verbrennt den Zusammenhang, isoliert die Details, durchstößt die Bildoberfläche, die Schärfeautomatik findet keinen Fixpunkt mehr, der Weg zurück durch das vielleicht rettende Loch wird zur Odyssee durch alle Schichten des Bewusstseins, vergleichbar nur noch mit Karl Valentins Katastrophenszenarien, wo er stolpernd, stotternd z.B. von einem ZUFALL erzählen will.
Ich wollte unbedingt aber auch spielen und so übertrug mir Michael auch diese Aufgabe. Die Herausforderung für mich als Spieler war: ich wollte beweisen, dass H. Müllers Text auf komplexe Art ganz einfach ist und auf jeden Fall nicht gescheit, keine Hirnerei.
Dieser Text begleitet mich bis heute. An anderer Stelle können Sie lesen, was ich bei einem Symposium, veranstaltet von der Uni Bochum, zu diesem Text von Heiner Müller vorgetragen habe mit dem Titel: Sag mal ist das ein Stück
Wieder Berlin 1997 bis 1999
 Wieder war es Michael Simon, der inzwischen als fester Regisseur an der Schaubühne arbeitete, und mich nach Berlin rief als Dramaturg und Mitarbeiter. Zuerst machten wir „Woyzeck“ mit Roland Renner und Rainer Philippi. Ich erarbeitete dazu eine Fassung, die im Zentrum immer wieder von Andres und Woyzeck ausging, die beiden Schauspieler, die Rollen immer wieder tauschten und aus diesem Kern wurde auch Woyzeck und Marie oder Woyzeck und Hauptmann u.s.w.
Wieder war es Michael Simon, der inzwischen als fester Regisseur an der Schaubühne arbeitete, und mich nach Berlin rief als Dramaturg und Mitarbeiter. Zuerst machten wir „Woyzeck“ mit Roland Renner und Rainer Philippi. Ich erarbeitete dazu eine Fassung, die im Zentrum immer wieder von Andres und Woyzeck ausging, die beiden Schauspieler, die Rollen immer wieder tauschten und aus diesem Kern wurde auch Woyzeck und Marie oder Woyzeck und Hauptmann u.s.w.
Das Büchner-Fragment lesen wie den Pergamon-Fries. Meine Faszination an diesem Text formulierte ich für das Programmheft der Schaubühne.
Dance me to the end of love
Zu dem Team: Michael Simon, Daniela Kranz und mir stieß Stefan Pucher, zuständig für die Musik und für sehr viel mehr verantwortlich. Wir machten „Von einem der auszog das Fürchten zu lernen“ mit Robert Hunger-Bühler in der Titelrolle.

 Danach verließ Michael Simon die Schaubühne. Andrea Breth war kurz zuvor gegangen und nun sollte ich mit Peter Ahrens, mit dem ich die künstlerische Leitung des Hauses teilte und Jürgen Schitthelm eine neuen Anfang für dieses Theater finden. Mit dem Einstieg von Thomas Ostermeier und Sasha Walz war meine Arbeit in Berlin beendet.
Danach verließ Michael Simon die Schaubühne. Andrea Breth war kurz zuvor gegangen und nun sollte ich mit Peter Ahrens, mit dem ich die künstlerische Leitung des Hauses teilte und Jürgen Schitthelm eine neuen Anfang für dieses Theater finden. Mit dem Einstieg von Thomas Ostermeier und Sasha Walz war meine Arbeit in Berlin beendet.
Während dieser Zeit kam ich auch wieder zum Spielen. Ich konnte in drei verschiedene Rollen einspringen: in einer wunderbaren Arbeit von Edith Clever mit Martina Krauel als Elektra, für Robert Hunger-Bühler in Schroffenstein von Kleist und für Wolf Redl in einem Stück von Eduardo de Filippo.
Diese zwei Jahre in Berlin waren sicher nicht mehr die große Zeit der Schaubühne, aber um die Bühne herum war noch der Geist eines außergewöhnlichen Theaters in dem die einzelnen Abteilungen nicht wie üblich und meist kaum vermeidbar einen großen Teil ihrer Energie untereinander oder gar in sich selbst aufzehren, sondern alles arbeitete im lustvollen Einsatz für die jeweilige Vorstellung und egal, ob Premiere oder irgend eine andere Vorstellung. Ich erinnere noch die Bauprobe von „Woyzek“. Wie selbstverständlich waren alle Abteilungen dabei, von der Requisite über den Ton, die Werkstätten, Licht u.s.w. und die Schauspieler. Und Alle spielten irgendwie mit. Ein ganzes Theater machte Theater.
Was Ich vorausdenke, kann gar nicht eintreten, dafür ist sich jede Wirklichkeit zu schade, daß sie sich von mir erfinden läßt. (Theresia Walser)
Neue Heimat. Graz. Theatermacher.
Von 2000 bis 2004 habe ich bei Matthias Fontheim, inzwischen Schauspieldirektor in Graz inszeniert, nachdem wir uns in Freiburg kennen gelernt hatten und später in Hannover und München in den Leitungsteams zusammenarbeiteten.
 Theatermacher mit Otto David in der Titelrolle. Otto wurde für mich etwas ganz Besonderes und ich konnte mir eigentlich kein Stück in Graz ohne ihn vorstellen. Mit dem Theatermacher wollte ich auch meine Rolle in diesem Gewerbe überprüfen und da kam mir Thomas Bernhards Stück über Glanz und Elend, Sehnsucht und Wirklichkeit und sein notwendig größenwahnsinniger Anspruch gerade recht.
Theatermacher mit Otto David in der Titelrolle. Otto wurde für mich etwas ganz Besonderes und ich konnte mir eigentlich kein Stück in Graz ohne ihn vorstellen. Mit dem Theatermacher wollte ich auch meine Rolle in diesem Gewerbe überprüfen und da kam mir Thomas Bernhards Stück über Glanz und Elend, Sehnsucht und Wirklichkeit und sein notwendig größenwahnsinniger Anspruch gerade recht.
King Kongs Töchter und Kleine Zweifel
von Theresia Walser
Mit Monique Schwitter und erstmals auf der Bühne Martin Bretschneider. Er spielte die Figur des Rolfi, bezaubernd. Wie schon beim Theatermacher hab ich auch das Bühnenbild gemacht.
 Auf der Bühne die Versuchsanordnung. Eine verschworene Gesellschaft aus Pflegerinnen und Alten spielen den Ernstfall unerbittlich durch, schenken sich nichts, sind trunken vor Anstrengung – nüchtern kann man das Problem Sterbehilfe wohl nicht zuende denken. Ein Text, der auf einem Vulkan tanzt, der täglich gewaltiger wird.
Auf der Bühne die Versuchsanordnung. Eine verschworene Gesellschaft aus Pflegerinnen und Alten spielen den Ernstfall unerbittlich durch, schenken sich nichts, sind trunken vor Anstrengung – nüchtern kann man das Problem Sterbehilfe wohl nicht zuende denken. Ein Text, der auf einem Vulkan tanzt, der täglich gewaltiger wird.
Wie gehe ich mit dem Alter um, wie kann man sich mit Anstand verabschieden... Eltern, zum Beispiel, wie bleiben sie in meinen Augen voll und kräftig, die ersten Helden eines Kindes, wie behalten sie ihre Würde. Was ist zu tun, damit sie nicht in die Matratze sickern. Und die Alten, jeder allein in dem Grauen, was stirbt da Alles ab. Der Blick in den Spiegel, an sich hinunter, was sollen all diese Gliedmaße, was haben sie alles getan, was haben sie alles versäumt.
Zuvor hatte ich zusammen mit Daniela Kranz den großartigen ersten Theatertext von Theresia Walser inszeniert und ausgestattet. „Kleine Zweifel“ mit Regina Schweighofer als Wendla Teusch
Goethes Iphigenie
2001. In einem Bühnenbild von mir, einem Raum am Rande der Unendlichkeit. Wieder mit Monique Schwitter und Martin Bretschneider als Iphigenie und Orest. Kostüme Rike Russig, Musik Matthias Thurow. ...Schönheit oder Intelligenz, ein deutscher Gegensatz, aber die Interpretation von Iphigenie hat darunter immer gelitten.
Ich denke, das mit der Schönheit hat sich so ziemlich erledigt, wenn man den Kritikern trauen darf in ihrer Beurteilung des Sprechens von gebundener Sprache am Theater. Nun, wir haben sicher viel vergessen von der Tradition, wie man solche Verse spricht, aber viel haben wir auch zu recht vergessen. Es ist eine neue, unserer Zeit um adäquate Formen zu finden, wie man Goethes großartigen Versen gerecht wird. Und ich meine, das der Schlüssel heute wesentlich im radikal geformtem Rhythmus zu suchen ist, in schnellen Tempi, in harten Tempowechseln, gewonnen aus dem Widerstreit von Inhalt und Form. Größtmögliche Transparenz bei oftmals ganz hartem Beat oder weichsten Balladentönen; Pausen.
Wie dünn liegt Kultur und Barbarei beieinander. Wir wissen es heute, nicht mal mehr ein Blatt Papier ist dazwischen, nur mehr ein Mouse-Click. Und Goethes Sprache – der sogenannte Wohlklang seiner Verse – sind Einlassung, sind Kampf gegen das bösartige Chaos, das Grauen der menschlichen Natur, die Willkür der Götter.
Die wütende Verständnislosigkeit über den „Schuldzusammenhang alles Lebendigen“ (W.Benjamin)
Bis aufs äußerste knapp unter Goethes Versen gibt es kein Halten mehr. In ihnen hat es die zitternde Schönheit des weiten Blicks, den man genießen kann, wenn man mitten im Lager von Buchenwald nahe Weimar steht. Dianens Hain, ein dünner Ort am Rande der Unendlichkeit. Dort kämpft Iphigenie mit ihrer Liebe zur Wahrheit – vielleicht ihr Erbteil seit sie nach Aulis gelockt wurde – entscheidet sie sich den gefährlichsten Weg zu gehen. Die, von so vielen Interpreten geschmähte Tat Iphigenies, sich und ‚ihr Volk’ Thoas auszuliefern mit der Preisgabe der Verschwörung, ist ihre große Tat – sie steht mit größtmöglichem Risiko zu ihrer Überzeugung wie der Held in fast jeder guten Geschichte. Human wird sie erst in dem Augenblick, in dem Humanität nicht länger auf sich und ihrem höheren Recht beharrt.
Nathan der Weise
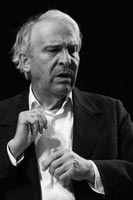 Lessings kleines Welttheater, großes Volkstheater um die Katastrophen seiner Zeit, die in vielem noch und immer mehr die Katastrophen unser Zeit sind. Mit Otto David als Nathan, Martina Stilp, wieder Martin Bretschneider und für mich neu, eine tolle Begegnung, Barbara Hammer als Daja, die dem Stück mit ihrer Person das wesentliche Zentrum gab. Bühne von mir, Kostüme Gabi Mai und Musik Matthias Thurow.
Lessings kleines Welttheater, großes Volkstheater um die Katastrophen seiner Zeit, die in vielem noch und immer mehr die Katastrophen unser Zeit sind. Mit Otto David als Nathan, Martina Stilp, wieder Martin Bretschneider und für mich neu, eine tolle Begegnung, Barbara Hammer als Daja, die dem Stück mit ihrer Person das wesentliche Zentrum gab. Bühne von mir, Kostüme Gabi Mai und Musik Matthias Thurow.
Über dieses Stück von Lessing ließe es sich stundenlang erzählen, ich will versuchen mich auf ein paar, mir wesentliche Punkte zu konzentrieren. Auf diesen bitteren und gleichzeitig humorvollen Aufriss, auf diese Herausforderung der Extraklasse, Lessings Wut und Lessings Lachen als Chance in die größer werdenden Risse der Welt hineinzufallen.
Dieser wunderbar fein ziselierte Nagel, eingeschlagen in Fleisch und Blut, in das Chaos des Leidens, in schier unendlichen Tod.
Das Stück spielt in Jerusalem zur Zeit der Kreuzzüge. Unter den Brettern die die Welt bedeuten lauern die Toten und schreien nach Rache. Der Tanz der Toten, der immer wieder die Lebenden in ihren Reigen zwingt. Die Aufgabe jeder Kultur diese Macht zu brechen, oder vielleicht besser, in friedliche Bahnen zu lenken.
Die Bilder der Toten, Nathans, des Tempelherrn, Saladins usw., sind eingebrannt in ihre Gehirne und fressen sich langsam aber stetig in ihre Seelen. Dort würden sie haften bleiben und das tun sie auch bei allzu vielen Menschen und nicht selten ein Leben lang und länger, werden als Vermächtnis weitergegeben.
Die Toten haben keinen Ruheplatz in ihren Herzen gefunden. So geistern sie durch die Körper auf der Suche nach Orten, von denen aus sie die Lebenden bestimmen, anführen können. Das kann der Kopf, die Gedanken, das Sprachzentrum ebenso sein wie die Faust, das Auge, der Ellenbogen. Scheint der Lebende sie an einem Ort ihrer Macht besiegt zu haben, sind sie leicht schon an einem anderen und richten von dort großen Schaden an, bevor wir sie vielleicht dann dort lokalisieren. So wird es bleiben bis wir sie zur Gänze erkannt und ihnen einen Ruheplatz in unserem Herzen zugewiesen haben.
Saladin mordet prinzipiell alle Tempelherrn, die ihm unter die Finger kommen; da lässt er einen leben, ganz sentimental, weil er ihn an seinen verschwundenen Bruder erinnert, und hat das sogleich wieder vergessen. Nathan erinnert ihn wieder an diesen Menschen und er ist gezwungen nun endlich doch einmal, diese Geschichte des verschwundenen, toten Bruders zu formulieren, anzunehmen und in Person des Tempelherrn mit allen seinen Seiten, den guten wie den schlechten, zu erkennen.
Die Figuren in diesem Stück versuchen viel um ihr Handeln nicht von Vorurteilen – von den Toten her – bestimmen zu lassen, da sie diese aber oft noch nicht wirklich überwunden haben, noch nicht mal ihre Existenz kennen, finden die Toten den Weg in ihr Herz nur allzu oft.
Ob wir unser Ohr an diesen möglichen Katastrophen haben, also den Mut zum heiligen und heilenden Schrecken, zum befreienden Lachen, wird über die Schönheit einer Aufführung entscheiden.
Der Schein trügt
Mein drittes Stück von Bernhard, ich hatte 1980 am Bremer Theater „Vor dem Ruhestand“ inszeniert, das rhythmisch für mich am radikalsten gebaute Stück von ihm. Und ich habe schon damals eine Hassliebe zu diesem Autor entwickelt. Immer wenn man mich aufforderte ein Stück von ihm zu machen, habe ich erst mal abgesagt. „Theatermacher“ sollte ich schon mal in Zürich machen. Anfangs geht mir dieses unendliche Gequatsche immer unendlich auf die Nerven, aber, wenn ich dann mal am arbeiten bin, faszinieren mich Bernards Wortkaskaden immer und immer mehr.
 Trotzdem, jedes Mal stelle ich mir die Frage neu: Sind diese Vernichtungs- und Selbstvernichtungsorgien von Bernhard produktiv und besonders jetzt, wo er so völlig zum unwidersprochenen Klassiker gemacht wurde. Taugt er überhaupt, wenn das Vergnügen der Provokation wegfällt. Ist der Narr zum Opa geworden wie sein wichtigster Regisseur, der große Clown, an dem nur mehr die Pappnase rot ist.
Trotzdem, jedes Mal stelle ich mir die Frage neu: Sind diese Vernichtungs- und Selbstvernichtungsorgien von Bernhard produktiv und besonders jetzt, wo er so völlig zum unwidersprochenen Klassiker gemacht wurde. Taugt er überhaupt, wenn das Vergnügen der Provokation wegfällt. Ist der Narr zum Opa geworden wie sein wichtigster Regisseur, der große Clown, an dem nur mehr die Pappnase rot ist.
Natürlich, Bernhards Wortschöpfungen sind oft vergnüglich, die Radikalität seiner Formulierungen großartig. Aber in unserer Zeit, wo das alte Mitteleuropa seine geschützte Position zwischen den Blöcken verloren hat und immer unerbittlicher in die Kälte der internationalen Kapital/ Machtverhältnisse hineingehalten wird, das antiautoritäre Kind mit reichen Eltern, natürlich krank, natürlich vom Wehrdienst befreit, muss plötzlich Haltung zeigen, den Kopf hinhalten – sind da nicht Bernhards schönste Orgien der sich im Schmerz windenden Körperköpfe nur mehr geschmacklos, nur mehr witzig. Obszöne Nabelschau.
Natürlich Theaterfutter, haben diese Texte doch schon viele, sogenannte große Schauspieler ihr Handwerk vorführen lassen zur Mehrung ihres Ruhmes und Bernhards. Ein Jahrmarkt der Eitelkeiten. Nur die sog. Skandale gaben diesen Stücken den Schein der Moderne, dahinter teuerst ausgestattetes braves Staatstheater, unbehelligtes Schlafen im Zuschauerraum einerseits, theatralischste Empörung andererseits, aber warum sollten ausgerechnet das Publikum, besser die Kritiker, die einzigen sein, die bei diesen Veranstaltungen sich uneitel geben.
Oder ist Bernhard doch Becketts Erbe. Liegt hinter den äußerlichen Schrecken, den Skandalen, die ihn erst mal berühmt machen mussten, der wahre Schrecken: „Wir können die Welt nur verbessern wenn wir sie abschaffen“ und die Formulierung als einzige Utopie.
Handelt es sich bei Bernhard vielleicht doch um eine besondere, eine österreichisch-süddeutsche Spielart der Kritik an unseren Wertvorstellungen, der unabdingbaren Verlogenheit unseres täglichen Tuns. So spezifisch krass in dieser Landschaft, die so besonders gesegnet ist mit Naturschönem und Kunstschönen. Und in Bernhards so unendlichen kleinem Reden, Reden, Reden zeigt sich vielleicht am radikalsten, das alles Sehnen nach Werten, nach objektiven Werten, jede Standortbestimmung, jedes Glücksversprechen korrumpiert wird, schon korrumpiert ist, schon beim Formulieren ins Grauen umschlägt, wenn dahinter das Kalkül zum Vorschein kommt.
 Ich meine damit, in unserer Gesellschaft ist doch alles verfemt, was sich nicht rechnet. Gleichzeitig geht alle Sehnsucht nach dem, was sich nicht rechnet, zum Beispiel nach bedingungsloser Liebe oder nach Hingabe an eine Tätigkeit unabhängig von der Gratifikation, nach sportlichen und geistigen Leistungen, die keinem Kalkül unterworfen sind, nach zweckfreiem Dösen und Faulenzen oder auch nach grenzenlosem Luxus und rücksichtsloser Verschwendung. Alle diese Sehnsüchte werden enttäuscht, wenn sich ihre Erfüllung als verkapptes Geschäftsgebaren erweist, wenn also doch alles wieder einem Kalkül zugrunde liegt. Der Kapitalismus, der seinem Selbstverständnis zufolge angetreten ist, der größtmöglichen Zahl der Menschen das größtmögliche Glück zu ermöglichen, beeinträchtigt und beschädigt dieses Glück fortwährend, weil es ihm nicht gelingt, dass Kalkül, das dahintersteckt, unsichtbar zu machen.
Ich meine damit, in unserer Gesellschaft ist doch alles verfemt, was sich nicht rechnet. Gleichzeitig geht alle Sehnsucht nach dem, was sich nicht rechnet, zum Beispiel nach bedingungsloser Liebe oder nach Hingabe an eine Tätigkeit unabhängig von der Gratifikation, nach sportlichen und geistigen Leistungen, die keinem Kalkül unterworfen sind, nach zweckfreiem Dösen und Faulenzen oder auch nach grenzenlosem Luxus und rücksichtsloser Verschwendung. Alle diese Sehnsüchte werden enttäuscht, wenn sich ihre Erfüllung als verkapptes Geschäftsgebaren erweist, wenn also doch alles wieder einem Kalkül zugrunde liegt. Der Kapitalismus, der seinem Selbstverständnis zufolge angetreten ist, der größtmöglichen Zahl der Menschen das größtmögliche Glück zu ermöglichen, beeinträchtigt und beschädigt dieses Glück fortwährend, weil es ihm nicht gelingt, dass Kalkül, das dahintersteckt, unsichtbar zu machen.
Bernhard ist vielleicht der radikale Sichtbarmacher dieser Katastrophe. In Bernhards Monolog kann es also keinen Punkt geben, denn keine Behauptung hält länger als ihre Formulierung dauert. Karl und Robert. Die Zeit hat sie totgeschlagen, jetzt schlagen sie die Zeit tot. Einsam, von Gott und der Welt verlassen, spüren sie sich nur mehr an ihrem Absterben. Und ihr Reden bunte Schreie um die Buh-Rufe der Gesellschaft nicht mehr hören zu müssen.
Lumpazivagabundus
Und das in Graz, der Stadt, die sich so gern mit ihrem Nestroy schmückt. Ein nicht einfaches Unterfangen, zumal ich die drei berühmten Rollen der Handwerker mit jungen Schauspielern besetzte. Martin Bretschneider, Alexander Weise, Sebastian Reiss. Ich folgte dem Alter Nestroys, als er das Stück schrieb und spielte, nicht der Aufführungstradition, bei der immer die Altkomiker die Rollen ‚Knieriem’ und ‚Zwirn’ beanspruchen. Aber natürlich, Otto David durfte nicht fehlen, er spielte den Tischler Hobelmann.
Für mich war entscheidend endlich einmal zu zeigen, das Nestroy auf der Bühne sichtbar und nicht nur bei Karl Kraus und anderen Verfechtern nachzulesen, ein richtig guter Autor ist. Ich wollte das schon seit meiner Schauspielschulzeit machen, aber bei all den Aufführungen, die ich zu Gesicht bekam, wirkte letztendlich doch alles immer so läppisch. Aber dann, in Graz, wusste ich: bei Nestroy gibt es nicht diese dummen Figuren die in noch dümmere Situationen tapsen. Nestroy liebt die Menschen und findet bescheuert, hasst fast alles was sie tun. Das ist erst mal die Vorraussetzung. Es wurde eine richtig gute Arbeit. Für die großartige Musik war Matthias Thurow verantwortlich, der auch die wunderbaren Töne zu Iphigenie komponiert hatte. Thomas Limpinsel hat sich der Couplettexte angenommen und Martin Bretschneider hat manchmal bei Vorstellungen seine Texte auf den Punkt neu erfunden.
Sündenfälle
Theater mit Puppen in der Wiener Porzellangasse im 9.Bezirk
Meine Schwester Julia Reichert hat zusammen mit Christopher Widauer vor fünfzehn Jahren ein Figurentheater, das ‚Kabinetttheater’ gegründet. Wunderbare Dinge gelangen in den ehemaligen Räumlichkeiten der ‚1.Wiener Porzellanmanufaktur’ zur Aufführung in dem seit acht Jahren das Theater beheimatet ist und in dem meine Schwester auch lebt. So kann man in diesem letzten Wiener Salon ein an der Kasse gekauftes Zusehen anstrengungslos zum intimen Gespräch am Herd mutieren.
Das ‚Kabinetttheater’ hat seit ein paar Jahren seine Bühne auch für lebendige Schauspieler geöffnet und produzierte 2004 „Sündenfälle“ mit Texten von Daniel Charms und Konstanty Ildefons Galczinsky. Hier kam ich ins Spiel. Es galt ein Zusammenspiel von Puppen in verschiedenen Größen und auch Schauspielern, darunter der in diesen Dingen schon geübte Wolfi Berger, zu inszenieren. Die Figuren des Stücks werden von Puppen getragen, aber manchmal geben sie ihre Figur an einen Schauspieler ab, später kommt die Rolle wieder zur Puppe zurück oder bleibt in beiden präsent. Ein spannender Vorgang.
 Für diese und für die gesamte, erfolgreiche Arbeit dieses ganz besonderen Theaters wurden wir, das ‚Kabinetttheater’ und ich, mit dem österreichischen Theaterpreis ‚Nestroy’ ausgezeichnet.
Für diese und für die gesamte, erfolgreiche Arbeit dieses ganz besonderen Theaters wurden wir, das ‚Kabinetttheater’ und ich, mit dem österreichischen Theaterpreis ‚Nestroy’ ausgezeichnet.
Weitere Arbeiten folgten, im Herbst 2005 die Opern „Le boeuf sur le toit“ von Darius Milhaud und „Der Ochse auf dem Dach oder The Nothing Doing Bar“‚von Bohuslav Martinu nach einer Farce von Jean Cocteau erarbeiten. Premiere war im Oktober 2005 im neuen Saal des Wiener Konzerthauses. Ernst Kovacic, der bekannte Geigenvirtuose und weitere 25 Musiker begleiteten das Geschehen auf der Bühne.
Und wir begannen mit der Reihe „Das andere Konzert“ am Wiener Konzerthaus.
Das andere Konzert 2004 - 2011
am Wiener Konzerthaus in Zusammenarbeit mit den Wiener Philharmonikern.
 Zusammen mit Christopher Widauer, der die Puppe führt, entwickelte ich und inszenierte einen Dialog zwischen einer lebensgroßen Klappmaulpuppe und ihrem Animator. Einen Dialog der sich um ausgesuchte Kompositionen und dessen Komponisten dreht. Ich habe es kaum zu glauben gewagt: ein Mensch, neben sich die Puppe, beide sitzend, zwischen manchmal hundert Musikern und vor 1900 Zuschauern im großen Saal – und es trägt, ja es funktioniert richtig gut.
Zusammen mit Christopher Widauer, der die Puppe führt, entwickelte ich und inszenierte einen Dialog zwischen einer lebensgroßen Klappmaulpuppe und ihrem Animator. Einen Dialog der sich um ausgesuchte Kompositionen und dessen Komponisten dreht. Ich habe es kaum zu glauben gewagt: ein Mensch, neben sich die Puppe, beide sitzend, zwischen manchmal hundert Musikern und vor 1900 Zuschauern im großen Saal – und es trägt, ja es funktioniert richtig gut.
2004
Modest Musorgsky: „Bilder einer Ausstellung“
ML: Roberto Abbado
2005
Wolfgang Amadeus Mozart: „Davidde penitente“
ML: Ton Koopman
Anton Webern: Sechs Stücke für Orchester und „ Passacaglia“
Franz Schubert: Symphonie Nr. 7
ML: Marko Letonja
Antonin Dvorák: Symphonie Nr. 8
ML: Yakov Kreizberg
2006
Robert Schumann: „Frühlingssymphonie“
ML: Fabio Luisi
Igor Strawinski: „Der Feuervogel“
ML: Marc Piollet
Wolfgang Amadeus Mozart: „Eine kleine Nachtmusik“
2007
Charles Ives: Three Places in New England
Gustav Mahler: 2. Satz, 4. Symphonie
ML: Ingo Metzmacher
Francis Poulanc: Konzert für zwei Klaviere
Gustavo Dudamel, Katia und Marielle Labèque (Klavier)
Nikolai Rimski-Korsakow: „Scheherazade“
ML: Vladimir Fedosejev

2008
Felix Mendelssohn-Bartholdy: „Schottische“
ML: Arild Remmereit
Béla Bartók: Violinkonzert Nr. 2
Heinrich Schiff und Patricia Kopatchinskaya (Violine)
Dimitri Schostakowitsch: Symphonie Nr. 5
ML: Yakov Kreizberg
2009
Joseph Haydn: „Der Bär“
ML: Fabio Luisi
Jean Sibelius: Symphonie Nr. 2
ML: Dimitri Kitajenko
Peter Iljitsch Tschaikowsky: „Pathetique“
ML: Dimitrij Kitajenko
2010
Modest Musorgsky: Bilder einer Ausstellung
Richard Strauss: Tod und Verklärung
Ludwig van Beethoven: Konzert für Klavier und Orchester Nr. 1 C-Dur op. 15
ML: Alexander Lonquich
2011
Gustav Mahler: Symphonie Nr.3
ML: Fabio Luisi
Edward Elgar: Konzert für Violoncello und Orchester e-moll op. 85
ML: Thomas Dausgaard
Niemand stirbt besser
 Zum 15jährigen Bestehen des ‚Kabinetttheaters’ wurde im Juli 2005 eine Produktion von Minidramen gezeigt. Dazu inszenierte ich eine Neuproduktion: Heiner Müllers „Herzstück“. Garantiert noch nie so großartig zur Aufführung gebracht, denn dieser Text ist wie für ein Tableau von Puppenspiel und Menschentheater geschrieben.
Zum 15jährigen Bestehen des ‚Kabinetttheaters’ wurde im Juli 2005 eine Produktion von Minidramen gezeigt. Dazu inszenierte ich eine Neuproduktion: Heiner Müllers „Herzstück“. Garantiert noch nie so großartig zur Aufführung gebracht, denn dieser Text ist wie für ein Tableau von Puppenspiel und Menschentheater geschrieben.
Zu diesem Ereignis erschienen beim Sonderzahlverlag das Buch „Niemand stirbt besser“. Mein Beitrag dazu:
Der Traum vom Spiel mit Puppen
endlich schizophren ,endlich frei
zwei meinungen, zwei haltungen
eine person
spieler und puppe
subjekt oder objekt
widerstreit von wirklichkeit und künstlichkeit
von wahrheit und täuschung
alles spiel
keine hierarchie
wer könnte unterscheiden
wer schöpfer, wer geschöpf
der spieler gibt durch sein agieren
fleisch an die puppe ab
die puppe form und haltung an den spieler
(ihre emotion ist immer fähigkeit, ist virtuosität)
so werden beide gleichberechtigt
geformt nach seinem bild
spiegelbild also
alles spiegel verkehrt
tod oder leben
eine drohung
Zwischen 2007 und 2010


entstanden in Koproduktion mit dem ‚Theater an der Wien’ sechs Arbeiten im Spiel mit Puppen, Schauspielern und Sängern. Spielort: ‚Die Hölle’, in den 1930ger Jahren Musikkabarett, später großer Pausenraum. Seit das Theater wieder als Opernhaus geführt wird, wird dieser Pausenraum ab und an als zweite Spielstätte genutzt.
Das Bild, Bühnenbild in diesem Raum tief unter der großen Opernbühne ein Arsenal verstaubter Bühnenrequisiten, dazwischen drei Diven aus längst vergangenen Tagen die von ihrer großen Zeit auf der Bühne oben träumen und immer, wenn sich mal ein Sänger von oben in ihre Katakomben verirrt, treiben sie ihre meist bösen Spielchen mit ihm bevor er wieder nach oben entlassen wird, leider immer ohne einen von Ihnen mitzunehmen.
Gute Götter – so ein Theater
Erste Auftragsarbeit für das Theater an der Wien im Rahmen des Programms ‚Kabinetttheater in der Hölle’ im großen Pausenraum des TAW.
Regie: Thomas Reichert
Text: Julia Reichert, Thomas Reichert, Christopher Widauer
Musikalische Arrangements: Georg Schulz
(Puppen)Spieler: Eva Ebelt, Thomas Kasebacher, Jennifer Podehl, Christopher Widauer
Sänger: Ulfried Haselsteiner (Tenor)
Musiker: Yvonne Weichsel (Flöte), Ruth Straub (Cello)
Don Giovanni fährt zur Hölle
Theater an der Wien / ‚Kabinetttheater in der Hölle’.
Regie: Thomas Reichert
Text: Julia Reichert, Thomas Reichert, Christopher Widauer
Musikalische Arrangements: Matthias Thurow
(Puppen)Spieler): Eva Ebelt, Thomas Kasebacher, Jennifer Podehl, Christopher Widauer Sänger: Alexander Puhrer
Musiker: Krassimir Sterev (Akkordeon), Yi Chen Lin (Geige), Michael Kinn (Schlagzeug)
Der fliegende Fidelio
Theater an der Wien / ‚Kabinetttheater in der Hölle’.
Regie: Thomas Reichert
Text: Julia Reichert, Thomas Reichert, Christopher Widauer.
Musikalische Arrangements: Matthias Thurow.
(Puppen)Spieler: Eva Ebelt, Thomas Kasebacher, Jennifer Podehl, Christopher Widauer
Sänger: Steven Scheschareg (Bariton)
Musiker: John Sass (Tuba), Michael Williams (Cello), Sandra Schennach (Klavier)
Ein bekehrter Wüstling
Theater an der Wien /‚Kabinetttheater in der Hölle’.
Regie: Thomas Reichert
Text: Julia Reichert, Thomas Reichert, Christopher Widauer
Musikalische Arrangements: Florian Kovacic.
(Puppen)Spieler: Eva Ebelt, Thomas Kasebacher, Jennifer Podehl, Christopher Widauer Phillip Stix (Gast)
Sänger: Erik Arman (Tenor)
Musiker: Antal Racz (Kontrabass), Sandra Schennach (Fender Rhodes), Haruhi Tanaka (Klarinette)
Haydn bricht auf. 7 Tage, die die Welt veränderten
Theater an der Wien / ‚Kabinetttheater in der Hölle’
Libretto: Thomas Reichert
Musikalische Leitung: Simeon Pironkoff
Regie: Thomas Reichert
Musik: Bernhard Lang
(Puppen)Spieler: Thomas Kasebacher, Lukas Lauermann, Jennifer Podehl, Christopher Widauer
Sänger: Anna Hauf (Mezzosopran), Tim Serverloh (Countertenor)
Musik: Sylvie Lacroix (Flöte), Christoph Waldner (Horn), Michael Moser (Cello), Krassimir Sterev (Akkordeon)
Philemon und Baucis
Theater an der Wien / ‚Kabinetttheater in der Hölle’
Arrangement, ML: Georg Schulz
Text und Regie: Thomas Reichert
(Puppen)Spieler: Ahmed Awad, Jennifer Podehl, Paula Podehl, Julia Reichert, Christopher Widauer
Sänger: Beate Ritter (Sopran), Juliette Mars (Mezzosopran), Mathias Frey (Tenor), Alexander Puhrer (Bariton)
Musiker: Ivana Poparic (Violincello), Philippe Mesin (Violine), Anton Hirschmugl (Klarinette), Georg Schulz (Akkordeon).
Im Kabinetttheater 2009 / 2010
Winterreise nach der Musik von Franz Schubert.
Mit Christopher Widauer und Marino Formenti (Klaviere)
Arrangements: Marino Formenti
Regie: Thomas Reichert.
Etwas Außergewöhnliches wurde für mich die Zusammenarbeit mit Marino Formenti, diesem ganz besonderen Ausnahmemusiker, der die Idee hatte, im Kabinetttheater die „Winterreise“ nach der Musik von Franz Schubert zur Aufführung zu bringen
Marino Formenti sah in der vom Leben eher bitter gezeichneten Klapp Maulfigur des ‚Onkels’ und der zwar großen, aber ganz unausgebildeten Stimme von Christopher Widauer und seiner eigenen Möglichkeit am Klavier die Komposition von Schubert auszudünnen, zu fragmentierten eine Chance, das brüchige und abgründige, das bitter politische in diesem Liederzyklus spürbar zu machen. Wie sehr die übliche Schubert-Rezeption davon meist nichts weiß, kann man mit Martin Walser erahnen:
"Wie klänge ein Schubert-Lied, wenn der, der es singt, nichts hätte als eine Stimme und eine Ausbildung, von dem Unerträglichen aber, gegen das diese Lieder geschrieben wurden, hätte er keine Ahnung!"
Der Abend im Kabinetttheater wollte auch ein Bild für die ‚Uhraufführungssituation’‚ sein, die J. von Spaun wie folgt beschrieben hat:
 "Schubert war durch einige Zeit düster gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in ihm vorgehe, erwiderte er: 'Nun, ihr werdet bald hören und begreifen.' Eines Tages sagte er zu mir: 'Komme heute zu Schober, ich werde euch einen Kranz schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig zu hören, was ihr dazu sagt. Sie haben mich mehr angegriffen, als dieses je bei anderen Liedern der Fall war.' – Er sang uns nun mit bewegter Stimme die ganze Winterreise durch. Wir waren durch die düstere Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft, und Schober sagte, es habe ihm nur ein Lied, Der Lindenbaum, gefallen. Schubert sprach hierauf nur: 'Mir gefallen diese Lieder mehr als alle, und sie werden euch auch noch gefallen...'
"Schubert war durch einige Zeit düster gestimmt und schien angegriffen. Auf meine Frage, was in ihm vorgehe, erwiderte er: 'Nun, ihr werdet bald hören und begreifen.' Eines Tages sagte er zu mir: 'Komme heute zu Schober, ich werde euch einen Kranz schauerlicher Lieder vorsingen. Ich bin begierig zu hören, was ihr dazu sagt. Sie haben mich mehr angegriffen, als dieses je bei anderen Liedern der Fall war.' – Er sang uns nun mit bewegter Stimme die ganze Winterreise durch. Wir waren durch die düstere Stimmung dieser Lieder ganz verblüfft, und Schober sagte, es habe ihm nur ein Lied, Der Lindenbaum, gefallen. Schubert sprach hierauf nur: 'Mir gefallen diese Lieder mehr als alle, und sie werden euch auch noch gefallen...'
Die Eisprinzessin von F.K. Waechter
Des Teufels Großmutter steckt in einem Dornbusch fest und möchte befreit werden. Der König von Sizilien liegt davor in verzweifelter Sehnsucht nach der Eisprinzessin. Die Eisprinzessin sitzt auf der Spitze ihres Eisbergs und will von all dem nichts wissen. Aus diesen drei unterschiedlichen Bedürfnissen zaubert F. K. Waechter ein amüsantes wie poetisches Lehrstück über die Liebe und das Glück.
Der Weg dahin ist wundersam, führt in die Hölle und auf das Meer, in fremde Kleider und Länder. Das Ziel scheint am weitesten entfernt, wenn es ganz nahe ist ... Verwicklungen, Verhüllungen und wundersame Erfüllungen auf kleinstem dramatischen Raum!
Regie: Thomas Reichert
Bilder und Figuren: Ahmed Awad, Julia Reichert, Mike Wanzenböck
Erzähler: Wolfram Berger
Spiel: Walter Kukla, Michaela Mahrhauser, Jennifer Podehl
Musik: Bartolo Musil
Kostüm: Burgis Paier
Technik: Martin Kerschbaumer
Regieassistenz: Constantin Schwab

Bastien und Bastienne und Der Schauspieldirektor
für die Salzburger Festspiele 2006 und 2007 konnte ich ein Projekt realisieren das zu etwas ganz besonderem wurde.
Am Marionettentheater Salzburg: Holzfigurenpuppenspieler, Sänger, Schauspieler und zwei Opern zusammenbringen von einem Komponisten, Mozart, aber aus zwei äußerst weit auseinander liegenden Schaffensperioden: ein Erstling ‚Bastien und Bastienne’ mit 12 Jahren geschrieben und ein spätes Werk ‚Der Schauspieldirektor’ mit großer Musik aber viel durchwegs unbrauchbarem Text.


Also eine Geschichte erfinden, die beide Stücke zusammenführt, ganz neue Texte schreiben. Ein Bühnenbild dazu finden, Marionetten gestalten. Dann Sänger beziehungsweise Schauspieler mit einbauen, die für die Puppen sprechen und singen und, oder in eigener Person mit den Puppen spielen. Dazu ein Orchester für das es im Marionettentheater eigentlich keinen Platz gibt.
Die Kunst bestand also auch darin, sehr viele Dinge in der Organisation ihrer Kunst bis zu den gewaltigen Größenunterschieden ihrer Protagonisten zu einem Abend zu verweben, aus dem Vielen ein Einfaches machen. Und es gelang letztlich ganz selbstverständlich in seinem Ablauf, in seiner Erzählung und humorvoll berührend in seiner Stimmung.
Die Festspiele konnten 2007 eine zweite Serie ermöglichen, dank der großzügigen Unterstützung von Donald und Jeanne Kahn.
Und hier und diesmal muss ich aufzählen wer da aller mitgemacht hat. Voran die Puppenspieler, dem so wunderbar professionellen und verrückten Ensemble am Salzburger Marionettentheater.
 Die Verspieltheiten der drei Protagonistinnen Eva Füdler, Michaela Obermayr und Ursula Winzer, die Erfinderfreude und technische Neugier von Pavel Tikhonov und Vladimir Fediakov. Die immer hilfreiche Gerda Michel und der Papa des Ganzen, der Chef der Bühne, der hilfreiche Pierre Droin. Die immer noch tätige, die Erfolgsgeschichte des Hauses in der dritten Generation bewahrende Gretl Aicher. Und Barbara Heuberger, die in ihrer uneitlen Art den Laden stemmt, schützt, viel, vielleicht alles von sich dafür aufs Spiel setzt und die Tradition des Theaters liebend und ihr nachhörend immer auch auf der Suche nach Neuem ist.
Die Verspieltheiten der drei Protagonistinnen Eva Füdler, Michaela Obermayr und Ursula Winzer, die Erfinderfreude und technische Neugier von Pavel Tikhonov und Vladimir Fediakov. Die immer hilfreiche Gerda Michel und der Papa des Ganzen, der Chef der Bühne, der hilfreiche Pierre Droin. Die immer noch tätige, die Erfolgsgeschichte des Hauses in der dritten Generation bewahrende Gretl Aicher. Und Barbara Heuberger, die in ihrer uneitlen Art den Laden stemmt, schützt, viel, vielleicht alles von sich dafür aufs Spiel setzt und die Tradition des Theaters liebend und ihr nachhörend immer auch auf der Suche nach Neuem ist.
‚Das Neue ist die Sehnsucht nach dem Alten’ ein schöner und so wunderbar einfacher Ausdruck für das
Bemühen so vieler von uns. Und da waren die Sänger, der so berührend verspielte Radu Cojacariu, als Assistent des Direktors, der für das große Casting den Antreiber gibt und der bei dem, für die letzte Auswahl entscheidenden ‚Probedurchlauf’ von ‚Bastien und Bastienne’ den Zauber Cola geben muss.
 Bernhard Berchthold, der Tenor für den Herrn Silberklang agierend, der auch als Bastien bestehen muss, ein große Puppenliebhaber in jeder Faser seiner Person. Ina Schlingensiepen und Christiane Karg die in solidarischer Konkurrenz das Casting bestreiten, dann die beiden Bastienne im Probedurchlauf um danach in virtuosesten Eifersuchtskolleraturen mit ihren Marionettendoubeln den Bühnenhimmel erklimmen. Alfred Kleinheinz, Direktor Frank der sich verständlich am Schluss gegen niemanden entscheiden mag. Und Lisi Fuchs, die Ihr Orchester einfühlsam und präzis durch den ganzen Abend führt.
Bernhard Berchthold, der Tenor für den Herrn Silberklang agierend, der auch als Bastien bestehen muss, ein große Puppenliebhaber in jeder Faser seiner Person. Ina Schlingensiepen und Christiane Karg die in solidarischer Konkurrenz das Casting bestreiten, dann die beiden Bastienne im Probedurchlauf um danach in virtuosesten Eifersuchtskolleraturen mit ihren Marionettendoubeln den Bühnenhimmel erklimmen. Alfred Kleinheinz, Direktor Frank der sich verständlich am Schluss gegen niemanden entscheiden mag. Und Lisi Fuchs, die Ihr Orchester einfühlsam und präzis durch den ganzen Abend führt.